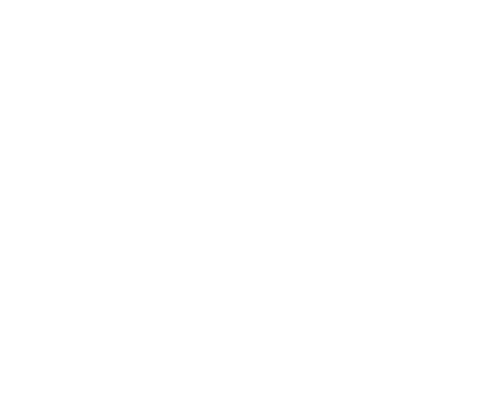Duale Ausbildung
- 3-4 Tage: Praktische Ausbildung im Betrieb unter Aufsicht deiner*s Ausbilders/Ausbilderin
- 1-2 Tage: Theoretische Ausbildung in der Berufsschule
- im Durchschnitt dauert die Ausbildung 3 Jahre
Überbetriebliche Ausbildung
Erweiterung der betrieblichen Ausbildung: Du wirst in externen Werkstätten ausgebildet oder in anderen Betrieben geschult.
Außerbetriebliche Ausbildung
Die Ausbildung findet nicht an einer Berufsschule statt, sondern an einer anderen Bildungseinrichtung. Das bedeutet, dass du praktische Übungen in einer Art Schule durchführst. Diese Form der Ausbildung kann eine Alternative sein, wenn du keinen Ausbildungsbetrieb findest.
Schulische Ausbildung
Es gibt auch einige rein schulische Ausbildungen im technischen oder sozialen Bereich, im Fremdsprachenbereich oder auch im Gesundheitswesen. Hier lernst du nur in Berufsschulen/Berufsfachschulen. In der Regel musst du aber ein betriebliches Praktikum während deiner Ausbildung machen.
Beispiele für:
- den technischen Bereich: medizinisch-technische*r Assistent*in
- den sozialen Bereich: Erzieher*in
- den Fremdsprachenbereich: Fremdsprachenkorrespondent*in
- das Gesundheitswesen: Altenpfleger*in