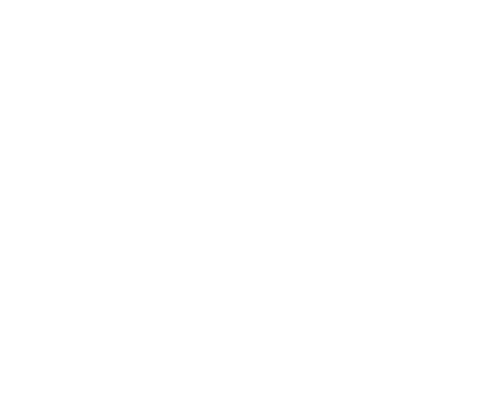Es gibt drei Bedingungen, die bei einer Kündigung erfüllt sein müssen (die Kriterien gelten für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen):
-
Eine Kündigung muss immer schriftlich sein: Eine mündliche Kündigung oder per Textnachricht (SMS/WhatsApp) oder als E-Mail verschickt, ist unwirksam. Eine Kündigung gilt nur, wenn sie die Form eines unterschriebenen Briefes hat.
-
Außerdem gilt die Kündigung erst, wenn sie die gekündigte Person erreicht hat. Sie muss bei dir im Briefkasten angekommen sein oder dir persönlich übergeben werden. Die Seite, die eine Kündigung verschickt, muss später nachweisen können, dass sie auch bei der gekündigten Person ankam. Beachte: Es ist sehr wichtig, dass die/der Arbeitgeber*in immer deine aktuelle Meldeadresse (Wohnadresse) hat. Nur wenn du die Post von der/dem Arbeitgeber*in sofort bekommst, kannst du rechtzeitig darauf reagieren.
-
Wenn es in der Firma einen Betriebsrat gibt, muss er zu der Kündigung vorher angehört werden. Frage deshalb beim Betriebsrat nach. Wenn der Betriebsrat nichts von der Kündigung weiß, ist sie nicht wirksam und du kannst dich dagegen wehren. Das gilt nur, wenn dir der/die Arbeitgeber*in kündigt.
Beachte: Eine Kündigung muss nur von der Seite unterschrieben werden, die sie ausspricht.
Wenn du eine Kündigung bekommst, musst du diese nicht unterschreiben! Es kann sein, dass du eine Empfangsbestätigung unterschreiben sollst. Das muss aber ein anderes Dokument sein (das nur bestätigt, dass du die Kündigung bekommen hast).
Vorsicht! Wenn dein*e Arbeitgeber*in will, dass du eine Kündigung unterschreibst, ist das vielleicht eine Kündigung in deinem Namen oder ein Aufhebungsvertrag!
Wenn du diese Dokumente unterschreibst, wird es schwer sich später gegen die Kündigung zu wehren. Grundsätzlich gilt: Du musst nichts sofort unterschreiben. Du kannst immer darum bitten, den Text in Ruhe zu Hause durchlesen zu können oder dir Rat holen.