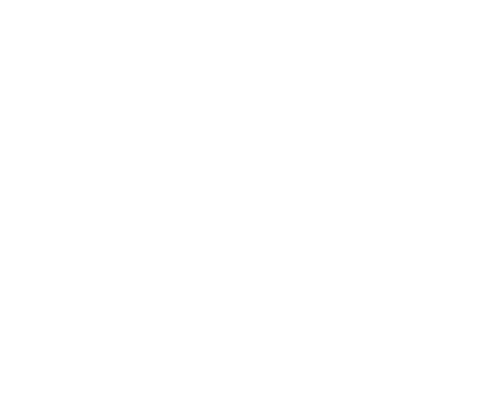Der Beratungsschein für Beratungshilfe ist für Personen mit wenig Geld (geringem Einkommen). Der Schein gibt diesen Personen die Chance, für wenig Geld eine Beratung eines Anwalts/einer Anwältin zu bekommen. Neben einer einfachen Beratung, kann auch eine anwaltliche Vertretung im außergerichtlichen Bereich erfolgen (Geltendmachung, Vergleichsabschlüsse etc.).
Dafür gibt es gewisse Einkommens- und Vermögensgrenzen. Rentner*innen, Arbeitslose, Empfänger*innen von Sozialhilfe oder Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erfüllen in der Regel diese Voraussetzung.
Personen, die eine ratenfreie Prozesskostenhilfe erhalten würden, können auch einen Beratungsschein bekommen. Wenn du mit einem Beratungsschein zu einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin gehst, musst du ihm/ihr höchstens eine Gebühr von 15 Euro zahlen. Die restlichen Gebühren bekommt er/sie vom Staat.
Der Antrag auf Beratungshilfe kann schriftlich per Formular oder mündlich beim zuständigen Amtsgericht gestellt werden. Für dich ist das Amtsgericht zuständig, das in dem Bezirk liegt, in dem dein Hauptwohnsitz ist.
Wenn du einen Beratungsschein beantragen möchtest, ist es hilfreich, vorher telefonisch beim Amtsgericht nachzufragen, welche notwendigen Unterlagen du brauchst und die Öffnungszeiten zu kennen.
Du solltest vorher das Antragsformular auf Bewilligung von Beratungshilfe ausgefüllt haben.
Das findest du hier: https://justiz.de/service/formular/dateien/agI1.pdf
Zusammen mit dem Formular und den notwendigen Unterlagen gehst du zur Rechtsantragsstelle. Dort werden die Bewilligungsvoraussetzungen geprüft. Hier gibt man dir dann eventuell den Beratungshilfeschein (wenn die Prüfung positiv ausfällt).
Meistens dauert es 2 Wochen bist du den Beratungsschein bekommst. Für jede außergerichtliche Angelegenheit stellt das Gericht nur einmal einen Beratungsschein aus. Das Beratungshilfeverfahren beim zuständigen Amtsgericht ist für dich kostenlos.
Die Beratungshilfe kann auch nach der Beratung durch den Anwalt/die Anwältin beantragt werden. Hierbei ist riskant, dass der Antrag nicht bewilligt wird und du dann das Geld für den Anwalt/die Anwältin selbst zahlen musst. Wenn du vor Beantragung eines Beratungsscheins sichergehen willst, dass dieser bewilligt wird, kannst du das mit Hilfe eines Prozesskostenhilferechners errechnen:
www.pkh-rechner.de
Wer ratenfreie Prozesskostenhilfe erhalten würde, kann auch einen Beratungshilfeschein bekommen. Darüber hinaus darf es keine andere Möglichkeit der kostenlosen Beratung/Vertretung in der außergerichtlichen Angelegenheit geben (zum Beispiel durch Gewerkschaft, Rechtsschutzversicherung). Eine weitere Voraussetzung ist, dass das zuständige Amtsgericht für die gleiche Angelegenheit noch keinen Beratungsschein für Beratungshilfe bewilligt oder abgelehnt hat.
Wie du den Beratungsschein beantragst:
Wenn du bei der Rechtsantragsstelle beim Amtsgericht den Beratungsschein beantragen willst, musst du diese Unterlagen mitbringen:
-
Ein gültiges Personaldokument (Personalausweis, Aufenthaltserlaubnis, Reisepass, …)
-
Deinen aktuellen Einkommensnachweis und den von deinem*r Ehepartner*in (zum Beispiel Lohnabrechnung, Bescheid von der Agentur für Arbeit oder Jobcenter)
-
Ggf. einen Nachweis über Unterhaltsverpflichtungen
-
Ggf. Nachweise über andere monatliche Zahlungsverpflichtungen
-
Kontoauszüge der letzten 3 Monate
-
Deinen aktuellen Mietvertrag und einen Nachweis über Heizungs- oder Stromkosten
-
Ggf. Unterlagen zu der Sache (zum Beispiel Kündigung, Abmahnung, usw.)
Wenn dein Beratungsschein bewilligt wurde, kannst du damit zu einem Anwalt/deiner Anwältin gehen. Grundsätzlich sind Anwälte/Anwältinnen verpflichtet, Mandanten/Mandantinnen mit bewilligter Beratungshilfe zu übernehmen. Wenn ein Anwalt/eine Anwältin überlastet ist oder das Verhalten des Mandanten/der Mandantin nicht gut ist, kann sie/er den Auftrag ablehnen. Bevor du einen Termin machst, solltest du den Anwalt/die Anwältin immer informieren, dass du einen Beratungsschein hast.